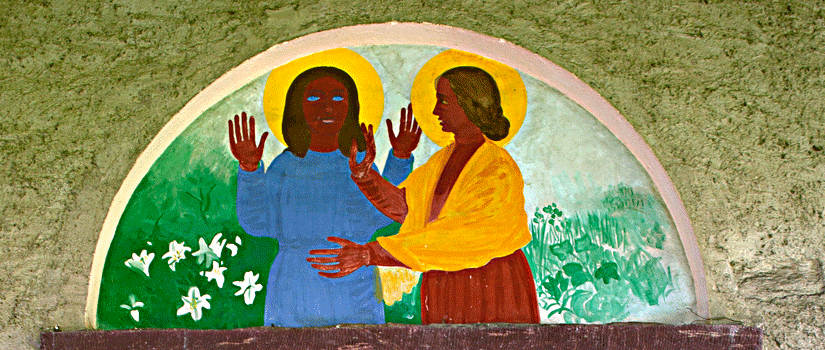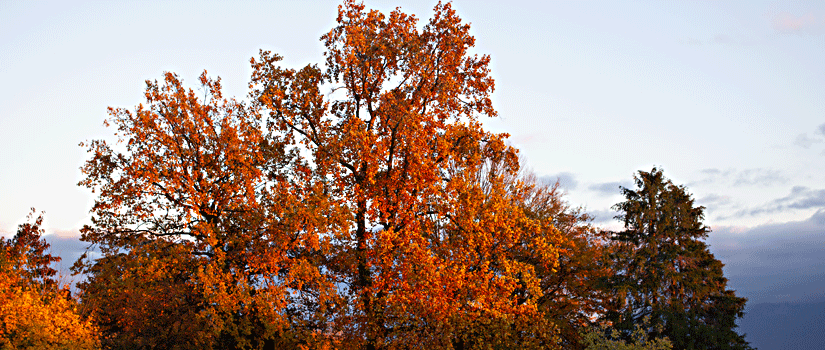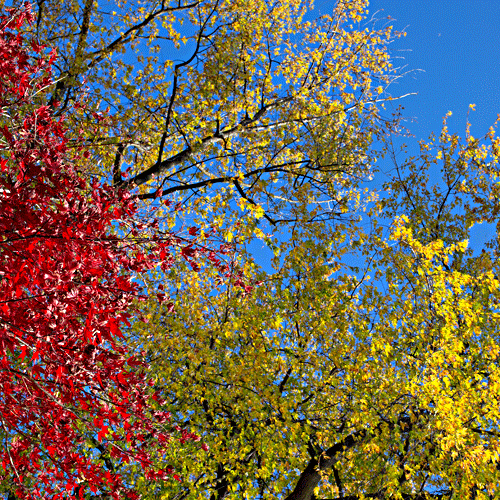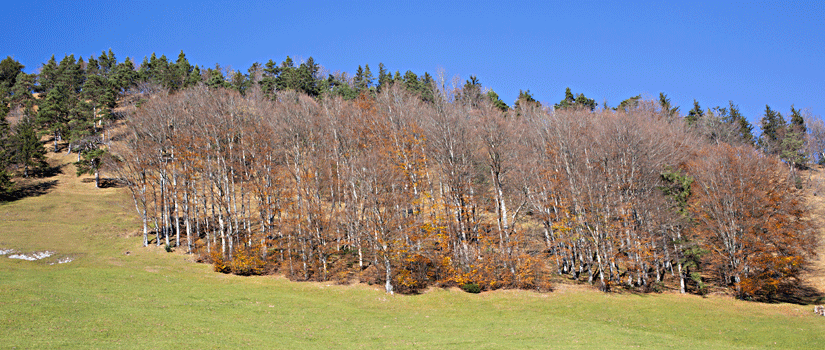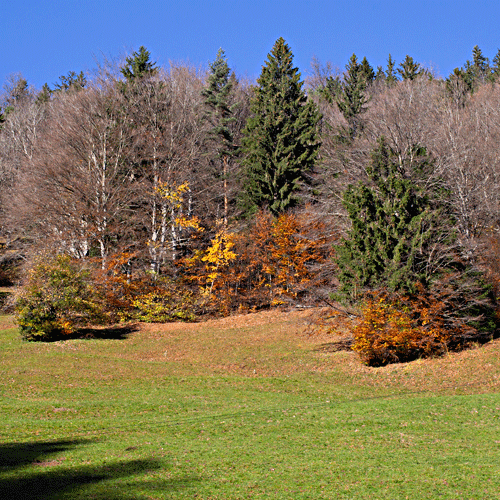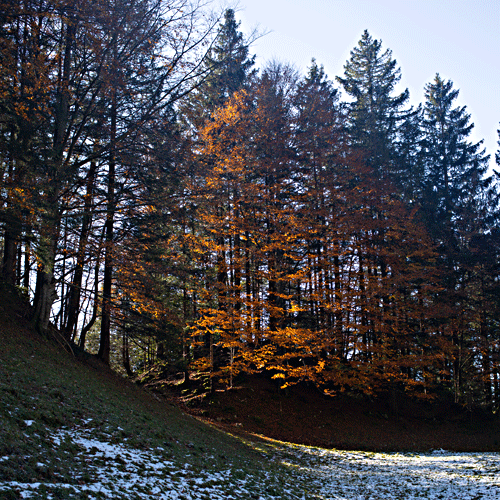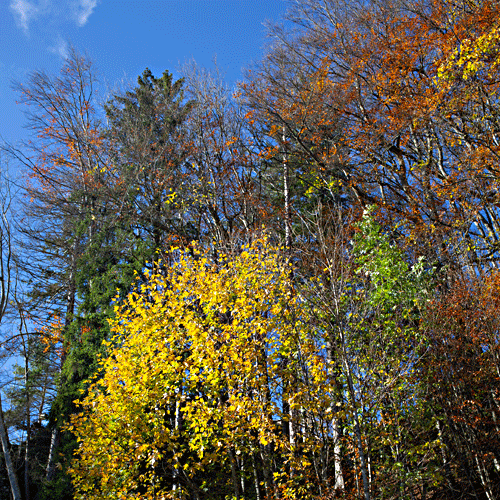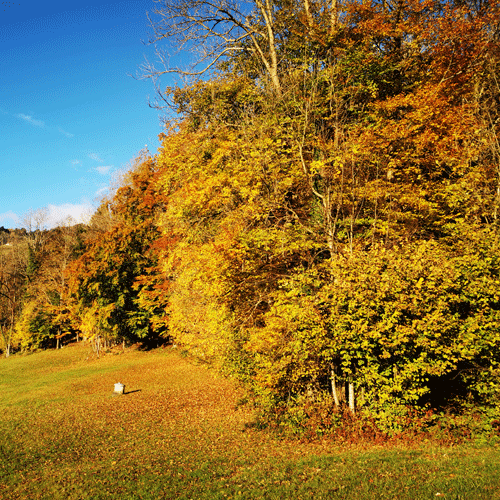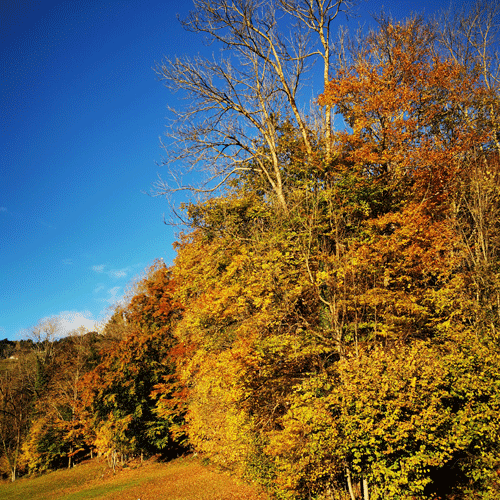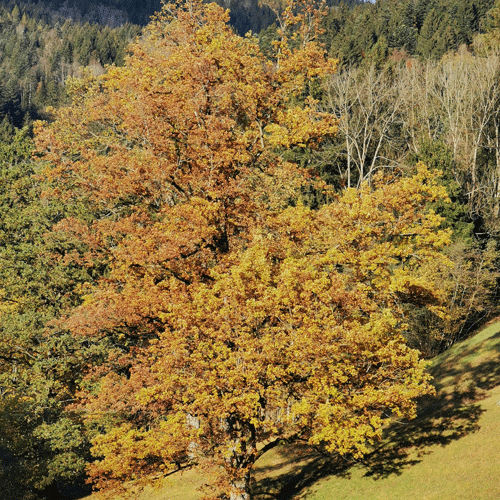Predigt vom 19. Dezember 2021 zu Lk 1,39-45
Liebe Brüder, liebe Schwestern
Begegnungen prägen unser Leben und können Ausdruck von unserem Glauben und unserer Nächstenliebe sein. Spezielle Begegnungen werden auch als Gott gegeben, oder sogar als Gottesbegegnung wahrgenommen. Franz von Assisi erzählt in seinem Testament:
«Es kam mir sehr bitter vor, Aussätzige zu sehen. Und der Herr selber hat mich unter die Aussätzigen geführt, und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich fortging von ihnen, wurde mir das, was mir bitter vorkam in Süssigkeit der Seele und des Leibes verwandelt». Test 1b-3a
Sowohl bei Franziskus wie auch bei Maria und Elisabeth geschieht Begegnung nicht irgendwie im Kopf und abstrakt. Nein, sie ist körperlich und sozial wahrnehmbar. Sie geht tiefer und wird auch körperlich wahrgenommen. Sei dies das hüpfende Kind im Bauch der Elisabeth oder sogar der Geschmacks-wandel vom bitter zur Süssigkeit der Seele und des Leibes bei Franziskus.
Vor zwei Monaten war ich an einer Ausbildung für Spitalseelsorger. Clinical Pastoral Training heisst sie. Dabei wurden seelsorgerliche Begleitgespräche aus der Praxis sowie freie Gespräche analysiert. Als Wegweiser wurde mir dabei der Merksatz: Weg von der Blackbox, aber Wertschätzung und Zeichen geben. (2x)
Blackbox: Der Mensch ist kein unbeschriebenes Blatt. Er hat eine Geschichte und Gefühle; Erinnerungen und Stimmungen. Bei einem schlechten Bauchgefühl helfen Argumente meist wenig. Vordergründig scheinen Meinungsverschieden-heiten oft sachliche Fragen zu betreffen. Aber der andere – dann gerne als Sturkopf wahrgenommen – muss mit seinen Gefühlen, Überzeugungen und Ängsten wahrgenommen werden. Er ist ein soziales Wesen aus Fleisch und Blut, kein Computer und kein Roboter. Weg von der Blackbox heisst hier tiefer sehen und den ganzen Menschen wahrnehmen. Mit Herz und Sinnen, Erinnerungen.
Bei der Begegnung von Maria und Elisabeth treffen sich keine Blackboxen, sondern Menschen, die sich kennen und sich gegenseitig etwas Wert sind. Der Text spricht von einer grossen Vertrautheit zwischen den beiden Frauen. Maria eilt und kann nicht warten, bei Elisabeth anzukommen, einzutreten und mit Elisabeth ihr Mutterglück zu teilen. Elisabeth spürt bei der Begegnung das Kind hüpfen in ihrem Bauch und ruft mit lauter Stimme. Wie viel Körperlichkeit hier mit der Begegnung und mit dem heiligen Geist in Verbindung gebracht wird, lässt staunen. Gott bewegt konkret. Mit Fleisch und Blut.
Wertschätzung und Zeichen geben ist der zweite Schritt in der Begegnung. Den anderen also nicht nur wahrnehmen, sondern auch segnen, wie es Beispielsweise Elisabeth mit Maria macht und sie so wertschätzt. Sie schweigt nicht und denkt Gutes, sondern Elisabeth bringt Gefühle auch im Ruf akustisch zum Ausdruck. Im Testament schreibt Franziskus von «Barmherzigkeit erweisen». Das meint hier nicht, den Armen mit Geld oder Gütern abspeisen, sondern die Aussätzigen körperlich wahrnehmen und pflegen, mit ihnen Kontakt pflegen. Sie wertschätzen, sich ihrer anzunehmen.
Vielleicht ist bei diesem Thema auch daran zu erinnern, dass das Schwyzer Kloster heute so zentral, nahe der Kirche liegt, weil die Kapuziner während der Pest in Schwyz sich auch um die Pestkranken verdient gemacht hatten und darum in die Stadt hinein geholt wurden. Sie hatten nicht nur gebetet und gepredigt, sondern sie hatten sich pflegend eingesetzt. Auf der Tafel dort steht unter anderem zu lesen: «Hier ruht in Gott Michael Angelus Meyer … im Rufe der Heiligkeit als Opfer des Pestkrankendienstes vom Klösterli St. Joseph in diese Kirche übertragen …» Und von nicht ungefähr betont der ehemalige Schweizer General der Kapuziner weltweit, Mauro Jöhri, dass die Kapuziner in den Anfängen dank der Pflege bei den Menschen beliebt wurden. Nicht als Kopfmenschen, sondern als Brüder der Nächstenliebe und der Pflege.
Elisabeth und Maria, aber auch Franz von Assisi sowie Michael Angelus Meyer haben es uns vorgelebt: Weg von der Blackbox, aber Wertschätzung und Zeichen geben. (2x) Und auch heute noch wird das unser Christsein prägen und gestalten. Vielleicht ist dieser Merksatz eine weitere Formulierung für den manchmal etwas abgegriffenen Begriff «Nächstenliebe»: Dem konkreten Menschen in meiner Nähe ein Gesicht geben, seine Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und ihm Wertschätzung und Zeichen zukommen lassen, das wünsche und rate ich uns immer wieder neu. Amen.