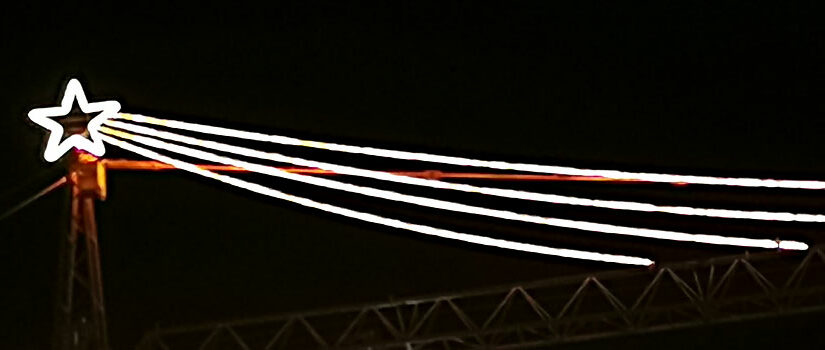ITE 2024/2; Einleitungsartikel: Es gibt heilige Berge …, aber auch heilige Schluchten und Höhlen. Und je nach Lebenserfahrung und -situation fühlt ein Mensch hier oder dort die Nähe zu Gott, zum Absoluten, zur Macht, zum Geheimnis des Lebens, usw. Davon erzählen religiöse Geschichten und Theologen. Humanistische Psychologen erforschen «Gipfelerfahrungen» (peak experiences) und stellen fest, dass vor allem junge Erwachsene davon geprägt werden, aber nicht nur.
«Auf der Alp fühle ich eine ganz besondere Nähe zu Gott», formuliert eine Mitfeiernde an einem Alpgottesdienst. Dabei ist es ihr wichtig, den anstrengenden Weg unter die Füsse genommen, geschwitzt und gekeucht zu haben. Erst so kann sie bei Gott richtig ankommen. Und dann die Weite, die Natur, die Stimmung, … «Oft fehlt mir die Sprache, aber mein Herz singt.»
Berge mit vielen Gesichtern
Ein anderer Gottesdienstteilnehmer erzählt, dass er regelmässig in die Berge beten, vor allem danken gehe. Als Jugendlicher sei er allein mit einem Stück Brot, einer Cervelat und einer Flasche Wasser in die Berge gegangen und habe nach Gott gesucht, geschrien. Fast verzweifelt sei er über Felsen gestiegen und habe sich auch verstiegen. Neue Wege gesucht. Oben auf dem Grat sei er einer Herde Schafe begegnet. Die Hirtenhunde seien knurrend vor die Schafe gestanden und so habe er gefährlich um die Herde herumklettern müssen. Angst und Verzweiflung waren mit ihm – und eine immense Sehnsucht.
Ganz verdattert habe er später sein Brot gegessen und realisiert, dass er keine Streichhölzer fürs Anfeuern dabei hatte. Und eine Cervelat sollte doch gebrätelt werden – das wäre schön. So habe er sich in schlechter Laune an den Abstieg gemacht und fand unerwartet zu einer verlassenen Feuerstelle, die noch leicht glimmte. Kein Mensch weit und breit. Sorgfältig befreite er die Glut, bliess sachte, konnte mit viel Geschick wieder ein Feuer entfachen, die Cervelat grillen, geniessen, Gott loben. Welch ein Fest! Und da erwachte in ihm die innere Gewissheit, Gott ist mit ihm, auch wo es im Leben rau, feindlich und herausfordernd werden kann. Diese Erfahrung begleitet ihn bis ins Alter – und immer wieder geht er in die Berge und dankt Gott für diese Lebens- und Seins-Gewissheit.
Visionen-Suche
Die halbsesshaften Pawnee-Indianer in Nordamerika betrieben Feldbau entlang der Prärie und ergänzten ihre Küche durch saisonale Jagd. Vor allem der Bison wurde gejagt. Wichtig war es diesen Indianern, zum Herzen der Erde zu finden. Heranwachsende Menschen gingen auf Visionen-Suche. Sie lebten allein in der Natur, bis ein Traumgesicht oder eine spezielle Naturerfahrung ihnen Antworten und Gewissheiten schenkte. Ein Lied erzählt vom «Herzen der Erde finden»:
Erst wenn ein Mensch viele Flüsse durchwatet, zahlreiche Berge bestiegen, ungezählte Nächte allein unter den Sternen geschlafen, sich von Kräutern, Samen und Wurzeln ernährt und bei Mondlicht im Fluss gebadet hat, kann er ans Herz der Erde finden und dort ruhen.
Dort werden ihm die inneren Augen aufgehen: Visionen und Träume zeigen ihm die Anhöhe, von der er den Morgenstern singen hören kann. Es ist das sanfte Lied eines Sterns, dessen Kraft so feinfühlig ist für die Harmonie der Welt wie ein Spinnennetz für den Wind.
Diversität in der Begegnung
Franz von Assisi zog sich bei seiner Gottsuche oft in Wälder, in Höhlen, auf Hügel zurück. Und da flehte er Gott um Nähe, Erleuchtung und Weisung an. Er fand immer wieder Antworten auf seine Lebensfragen und auf seine Gottsuche. Mit der Zeit wurde aus dem Waldsuchenden ein wandernder Nachfolger Jesu. Bruder Klaus scheint den Weg konträr gegangen zu sein. Bei seiner Gottsuche machte Klaus sich zuerst auf Wanderschaft und zog sich erst nach prägenden Erfahrungen in den Ranft zurück, um da in der Gegenwart Gottes zu verweilen.
Auch heutige Zeitgenossen verweilen gerne im Wald oder in den Bergen, um da zuerst einmal Kraft und Energie für ihr Leben zu schöpfen. Und manchmal finden sie dort ihre Nähe zu Gott, eine Lebensgewissheit, die trägt, Mut macht und Freude bereitet. Und manchmal ist es einfach eine tiefe Ahnung oder ein tragendes Vertrauen ins Leben. Oft fehlen dabei die Worte, um solche Erfahrungen zu benennen und wirklich zu verstehen. Auch sind die Erzählungen vielfältig und so unterschiedlich, wie die Menschen selber sind.
Gipfelerlebnisse
Der US-amerikanische Psychologe Abraham H. Maslow führte den Begriff «Peak Experiences» in die humanistische Psychologie ein. Seine Untersuchungen zeigen, dass die meisten (oder gar alle?) Menschen Gipfelerlebnisse in ihrem Leben machen: Momente tiefer Verbundenheit, von unbedingter Zugehörigkeit, der Aufhebung allen Getrenntseins, des Einsseins mit der Welt, tiefsten Glücks. Diese Erfahrungen sind vielfältig wie die Menschen, die sie erleben. Sie können therapeutisch wirksam werden, den freien Willen und Selbstbestimmtheit fördern.
Von Maslow ist vor allem die Bedürfnispyramide bekannt:
1. Psychologische Bedürfnisse
2. Sicherheitsbedürfnisse
3. Soziale Bedürfnisse
4. Individualbedürfnisse
5. Selbstverwirklichung.
Die oben thematisierten Gipfelerlebnisse können unter Selbstverwirklichung (Stufe 5) eingeordnet werden. Diese Stufe 5 hat im Verlauf der Jahre unterschiedliche Bezeichnungen erhalten: In seiner späteren Forschung assoziierte Abraham H. Maslow die Stufe mit dem Bedürfnis nach Selbstüberschreitung, nach Transzendenz.
Psychologische Erforschung
Ich möchte aus einem Vortrag von ihm (Vgl. Doubraw 2021) zitieren: «Als ich die Psychologie der Gesundheit zu erforschen begann, nahm ich die besten, gesündesten Menschen, die besten Exemplare der Menschheit, die ich finden konnte, und studierte sie, um zu sehen, was sie auszeichne. Sie waren sehr anders, in gewisser Weise verwirrend anders als der Durchschnitt.» Maslow fand heraus, «dass diese Menschen dazu tendierten, von mystischen Erfahrungen zu berichten, von Augenblicken grosser Ehrfurcht, Augenblicken des intensivsten Glücks oder sogar der Verzückung, Ekstase oder Glückseligkeit». Und weiter: «Diese Augenblicke waren das reine, das positive Glück. Alle Zweifel, alle Ängste, alle Hemmungen, alle Spannungen, alle Schwächen wurden zurückgelassen.»
«Gipfelerlebnisse können als wahrhaft religiöse Erfahrungen im … universellsten und humanistischsten Sinne des Wortes gelten.»
Maslow war überzeugt: «Sie (Gipfelerlebnisse – Red.) können wissenschaftlich untersucht werden. (Ich habe begonnen, dies zu tun.) Sie befinden sich innerhalb der Reichweite des menschlichen Wissens, sind keine ewigen Geheimnisse. Sie befinden sich in der Welt, nicht ausserhalb der Welt. Nicht bloss Priester machen sie, sondern die ganze Menschheit.» … «Gipfelerlebnisse können als wahrhaft religiöse Erfahrungen im besten und tiefsten, universellsten und humanistischsten Sinne des Wortes gelten.»
Oft unbewusste Erfahrung
Die nächste grosse Lektion, die Maslow gelernt hatte, war, «dass Gipfelerlebnisse weitaus häufiger vorkommen, als ich jemals erwartet hatte: Sie waren nicht auf gesunde Menschen beschränkt. Diese Gipfelerlebnisse hatten auch durchschnittliche und sogar psychisch kranke Menschen. In der Tat vermute ich jetzt, dass sie bei praktisch allen auftreten, allerdings unerkannt oder nicht als das genommen, was sie sind».
Der Psychologie war überrascht: «Praktisch jeder berichtet von Gipfelerlebnissen, wenn er auf sie angesprochen und befragt und in der richtigen Weise ermutigt wird.» … «Gipfelerlebnisse sprudeln aus vielen, vielen Quellen und jede Art Mensch kann sie haben. Meine Liste von Quellen wird immer länger, je mehr ich mich mit diesen Forschungen beschäftige.»
Literaturangabe: Erhard Doubraw (Hrsg.), Verbunden trotz Abstand, Von Gipfelerlebnissen und mystischen Erfahrungen. Beiträge von Abraham H. Maslow und David Steindl-Rast, Books on Demand, 2021.